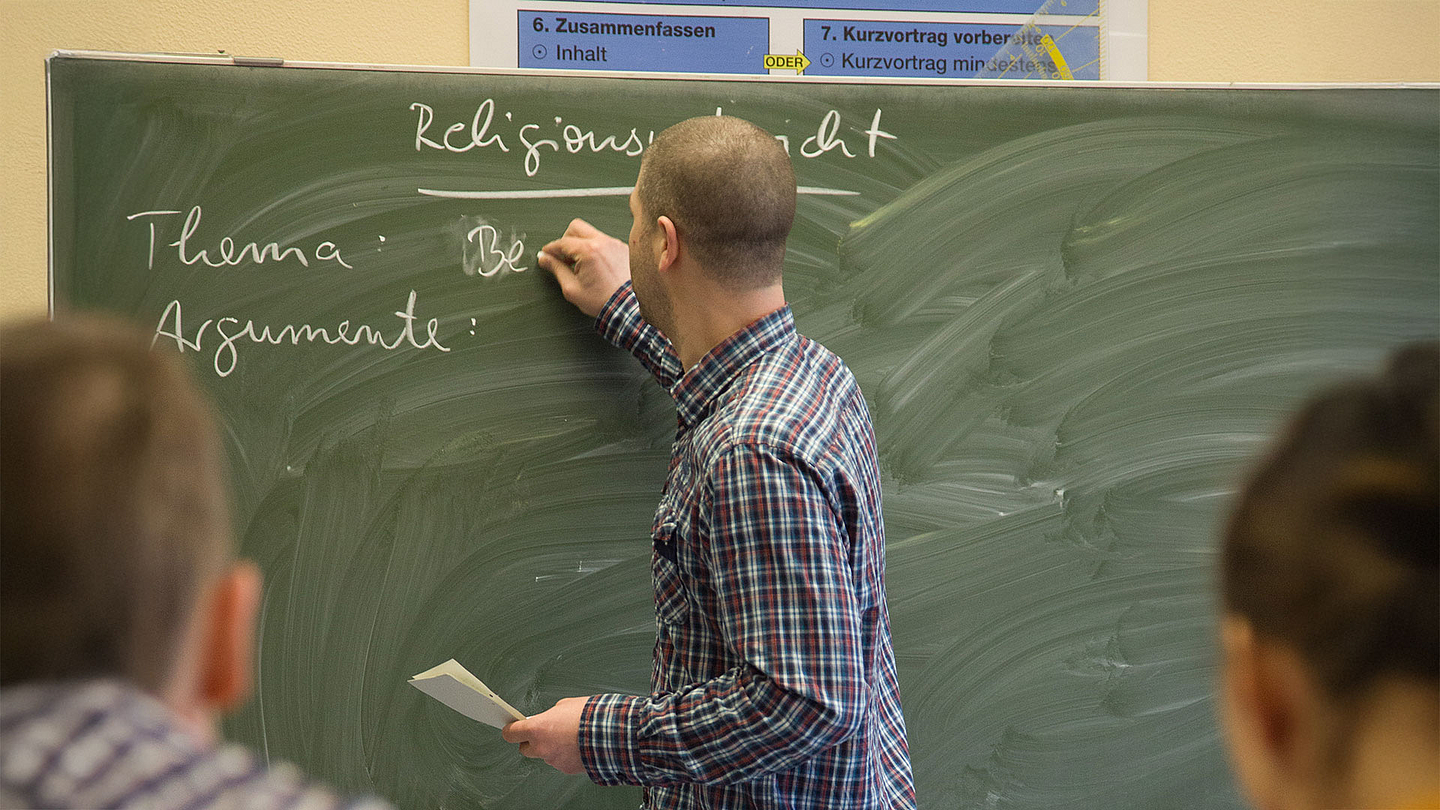Obwohl das Vertrauen der Deutschen in Institutionen und damit auch in die Kirchen schwinde, habe die Mehrheit der Bevölkerung nichts dagegen, «wenn Kinder mit christlichen Werten vertraut gemacht und im Geist des Christentums zu anständigen Menschen erzogen werden», sagt die Bildungsdezernentin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Prof. Dr. Gudrun Neebe mit Verweis auf den Kultur- und Religionssoziologen Detlef Pollack.
Mit dieser Zwiespältigkeit werde auch dem Religionsunterricht begegnet: Man bezweifelt seine Leistungsfähigkeit und findet seine Ziele unzureichend, hält unter Umständen den Unterricht insgesamt für überholt, stellt Neebe fest. Gleichzeitig werde aber die Vermittlung von Werten und fundiertes Wissen über «die» Religionen als besonders wichtig angesehen, so die Dezernentin. Das lassen die Ergebnisse der 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung erkennen, in der auch nach Einschätzungen zum Religionsunterricht gefragt wurde.

Von den rund 11,25 Millionen Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland besuchten im Schuljahr 2023/2024 ca. 54 Prozent den Religionsunterricht der evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer, berichtet Dr. Neebe. Das sind rund 6 Millionen Kinder und Jugendliche. Zum Islamunterricht gingen mehr als 1 Million.
Wichtig ist für Neebe, dass im Religionsunterricht nicht nur Wissen über Religion vermittelt wird. Schülerinnen und Schüler sollen Religion in ihrer Tiefenstruktur verstehen und nicht nur kognitiv, sondern auch emotional lernen können. «Denn gerade, wenn es zu Dialog und Begegnung zwischen unterschiedlichen religiösen Perspektiven kommt, entwickelt der Religionsunterricht Lebensrelevanz und trägt dazu bei, sich in einer multireligiösen bzw. multikulturellen Gesellschaft zurecht zu finden. Das ist sein Potential», sagt die Bildungsdezernentin.
Unterrichtsformen werden unübersichtlich
Inzwischen gebe es neben dem konfessionellen Religionsunterricht, konfessionelle Kooperationen, bald auch christlichen Religionsunterricht und in Hamburg den Religionsunterricht als ein von mehreren Religionsgemeinschaften gemeinsam verantwortetes Unterrichtsfach, beschreibt die Dezernentin eine immer unübersichtlich werdende Landschaft. Die Unterrichtsformen in der Praxis unterscheiden sich erheblich. Daher sei bei der Beurteilung Vorsicht geboten, gibt die Dezernentin zu bedenken.
Aus-, Fort- und Weiterbildung: Koblenzer Konsent gibt Grundlage
Um zu verdeutlichen, wie derzeit evangelische und katholische Religion unterrichtet werden oder zumindest unterrichtet werden sollten, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den sogenannten «Koblenzer Konsent» formuliert, berichtet Dr. Neebe weiter. Inzwischen werde der Text von Gremien und Einzelpersonen unterstützt und bildet die Grundlage für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften zur Erteilung von Religionsunterricht. Außerdem ermöglicht das Papier Interessierten einen vertiefenden Einblick in Inhalte und Ziele des Religionsunterrichts.
Nachgefragt zum Thema «Koblenzer Konsent»
Für Ausbildung von Lehrkräften und für die schulische Praxis im Fach evangelische Religion ist die Landeskirche kürzlich dem sogenannten «Koblenzer Konsent» beigetreten, der Grundsätze enthält, an denen sich Lehrkräfte ausrichten können. Wir sprachen mit der Bildungsdezernentin der EKKW, Prof. Dr. Gudrun Neebe, über den Konsent und seine Hintergründe. Das Interview führte ekkw.de-Redakteur Christian Küster.
Frau Dr. Neebe, bitte erklären Sie unseren Leserinnen und Lesern kurz, worum es beim «Koblenzer Konsent» geht.
Dr. Gudrun Neebe: Es geht darum zu verdeutlichen, was der evangelische Religionsunterricht ist und was die Schülerinnen und Schüler, die am Religionsunterricht teilnehmen, in diesem Unterricht lernen. Es werden also die Lernziele benannt und erläutert. Ich räume ein, dass manche Begriffe ein wenig nach Fachchinesisch klingen. Das liegt daran, dass diesen Konsent Fachleute formuliert haben.
Für Unterrichtsfächer wie Ethik oder Politik gibt es bereits ähnliche Orientierungshilfen - Warum musste jetzt auch für den Religionsunterricht ein Konsent gefunden werden? Gab es Unstimmigkeiten bei der Vermittlung von theologischem Wissen durch die Lehrkräfte?
Dr. Neebe: Letztlich gibt es zwei Gründe: Zum einen musste mit einigen Vorurteilen aufgeräumt werden, die über den Religionsunterricht – nicht nur den evangelischen - verbreitet werden: Der Religionsunterricht ist ein Schulfach wie andere auch und nicht Kirche in der Schule. Im Religionsunterricht wird daher auch nicht missioniert, wie immer wieder einmal behauptet wird. Hier wird niemand zu irgendetwas gezwungen: Weder zum Singen, noch zum Beten, auch nicht dazu, die Meinung der unterrichtenden Lehrkraft zu übernehmen. Es ist keineswegs so, dass der Schüler oder die Schülerin gute Noten bekommt, die die Meinung der Lehrkraft annimmt. Für Schulnoten gelten die gleichen Kriterien wie in anderen Schulfächern auch. Und daher ist der Religionsunterricht auch nicht einfach ein Laberfach, wie gelegentlich behauptet wird.
Weil aber Lehrkräfte, die Religionsunterricht erteilen, der einen und anderen dieser Behauptungen ausgesetzt sind, sind manche – vor allem jüngere Lehrkräfte verunsichert. Das ist der zweite Grund. Für diese und zu ihrer Entlastung sollte daher noch einmal kurz und knapp zusammengestellt werden, was der Religionsunterricht ist und was er leistet.
Vor welchen Herausforderungen stehen Lehrkräfte bei der Vermittlung von Glaubensthemen im Religionsunterricht?
Dr. Neebe: Zum Teil habe ich das gerade beschrieben. Lehrkräfte erleben Kolleg:innen, Schüler:innen und auch Eltern, die einen Teil dieser Vorurteile als Haltung, als Meinung mitbringen. Manchmal wird daher auch gedacht, dass im Religionsunterricht leicht gute Noten zu bekommen sind. Da kann dann die Empörung groß sein, wenn es Hausaufgaben oder nicht nur 1 und 2 gibt, wenn Lernstoff zu bewältigen ist.
Herausfordernd ist aber auch, dass sich durchaus viele Schüler:innen für dieses Fach interessieren und daran teilnehmen (ca. 127.000 Schüler:innen auf dem Gebiet der EKKW nehmen wöchentlich 2 Schulstunden am Religionsunterricht teil; das sind etwa 41 Prozent aller Schüler:innen), dass sie aber nur noch wenige Vorkenntnisse mitbringen, auf die Lehrkräfte aufbauen können. Darauf sind die Curricula und die Unterrichtsmaterialien noch zu wenig abgestimmt, so dass eine intensive Vorbereitung der Lehrkräfte nötig ist.
Warum ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler im Fach Evangelische Religion zu unterrichten? Was kann damit in unserer Gesellschaft bewirkt werden?
Dr. Neebe: Die Schule ist – wie schon die Kindertagesstätte - sozusagen die Gesellschaft im Kleinen. Hier wird das Miteinander gelernt und eingeübt, das nötig ist, um an unserer Gesellschaft als Bürger teilzuhaben: Gemeinschaft pflegen, Kompromisse finden, den anderen achten, mit dem Fremden respektvoll umgehen, miteinander debattieren um richtig und falsch, wertvoll, erhaltenswert etc. .
Hier erhalten Schüler:innen Antwortangebote auf große, wichtige, existentielle Fragen und üben ein, Entscheidungen zu treffen und bekommen Orientierung. Hier hören sie, dass es Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht gibt, dass aber auch Verantwortung und die Bereitschaft zur Vergebung wichtig sind.
Sie erfahren, dass es nicht nur den naturwissenschaftlichen und den betriebswirtschaftlichen Blick auf die Welt gibt, sondern auch die religiös-ethische Perspektive (4 Weltzugänge nach Jürgen Baumert). Sie erleben Wertschätzung und Angenommensein.
Der «Koblenzer Konsent»
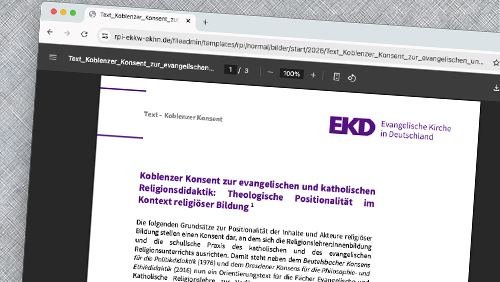
«Koblenzer Konsent zur evangelischen und katholischen Religionsdidaktik: Theologische Positionalität im Kontext religiöser Bildung.» Der Konsent ergänzt die bestehenden Leitlinien der Politik-, Philosophie- und Ethikdidaktik und bietet eine fundierte Orientierung für Religionslehrerinnen, Religionslehrer und schulische Praxis. Im Spannungsfeld zwischen religiöser Freiheit, theologischer Reflexion und schulischer Neutralität setzt der Text klare Leitlinien für Transparenz, Kontroversität, Respekt und Orientierung – zentrale Prinzipien für einen zeitgemäßen Religionsunterricht. Download beim Religionspädagogischen Institut der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.