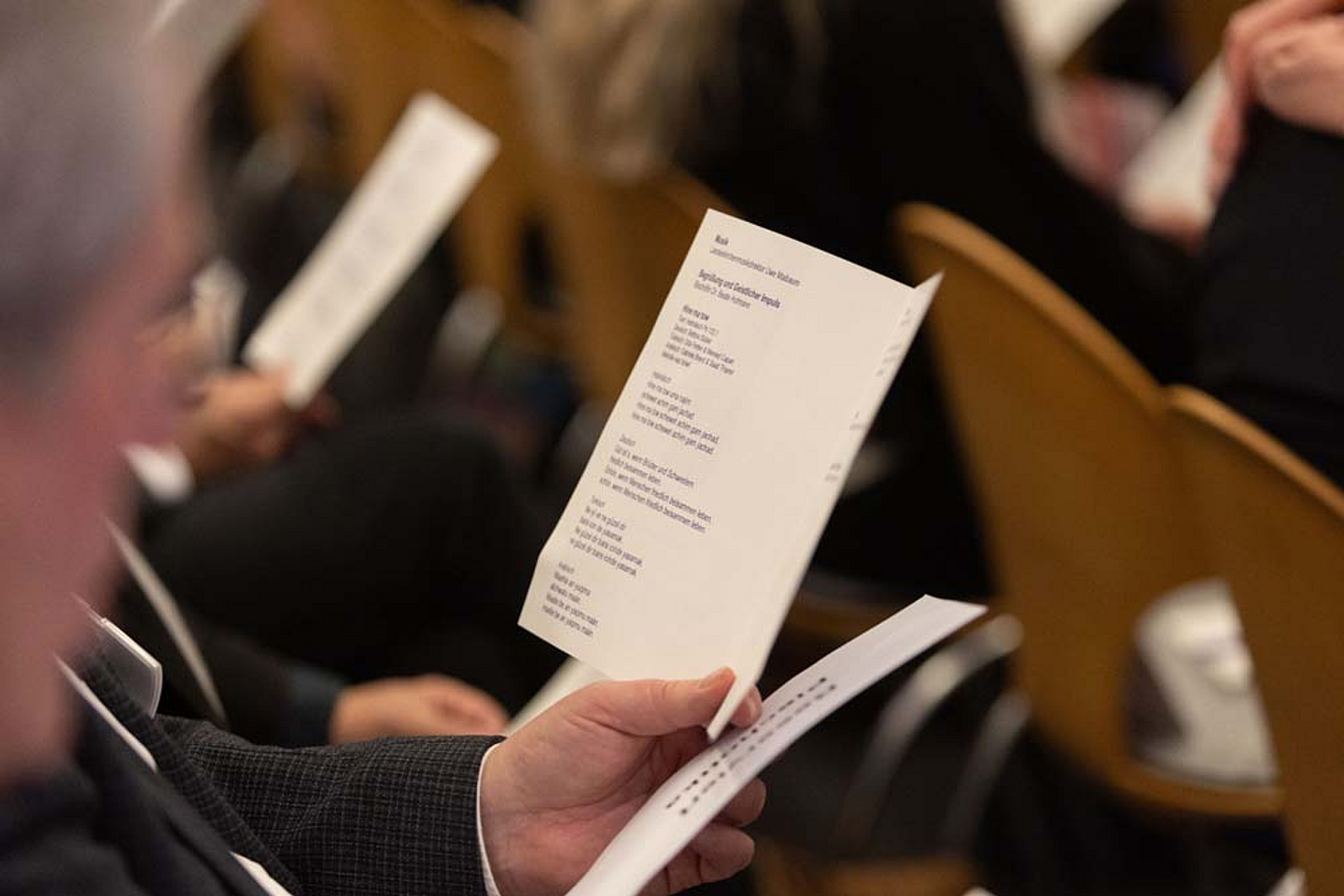Mehr als 100 Gäste aus Kirche, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur waren am Freitagabend (6. Dezember) ins Hans von Soden-Haus in Marburg gekommen, heißt es in einer Mitteilung der Landeskirche. Vor ihnen sprach der israelisch-deutsche Pädagoge, Publizist und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Prof. Dr. Meron Mendel. Zuvor hatte die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW), Dr. Beate Hofmann, eine Andacht gehalten.

«Wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Kritik an Israel und Antisemitismus?», fragte Mendel in seinem Vortrag. Darüber werde aktuell heftig debattiert. «Dass die Regierung Netanjahu für ihre militärischen Vorgehen oder ihre Siedlungspolitik kritisiert werden darf – und soll, steht außer Frage», so Mendel. Doch wie seien Aussagen zu bewerten, die Israel als koloniales Projekt darstellten oder die Selbstdefinition Israels als jüdischer Staat infrage stellten? Mendel verwies an dieser Stelle auf den Publizisten und Auschwitz-Überlebenden Jean Améry. Er habe bereits in den 1960er-Jahren beobachtet, dass Kritik an Israel oft als legitimes Ventil für antisemitische Ressentiments diene. Antisemitismus sei, so Améry, im Antizionismus enthalten «wie das Gewitter in der Wolke». Demgegenüber forderte Mendel in seiner Rede dazu auf, «Kritik im Modus der Liebe zu üben – auch gegenüber den Palästinensern».
Zuvor hatte Bischöfin Hofmann in ihrer Andacht deutlich gemacht, warum sich der Empfang der EKKW mit diesem Thema beschäftigte. Sie erinnerte an die Erklärung der Landessynode 2021, sich gegen jede Form von Antijudaismus und Antisemitismus zu wenden. «Wir wissen um die Mitverantwortung und Schuld von Christinnen und Christen, wir wissen, dass Theologie und Kirche dazu beigetragen haben, dass Jüdinnen und Juden ihre Koffer packen mussten, dass sie aus ihren Häusern vertrieben und ermordet wurden. Und wir sehen, wie Menschen in unserem Land wieder antisemitische Parolen brüllen oder Hassbotschaften schreiben. Wir erleben, wie die an manchen Punkten notwendige und legitime Kritik an israelischer Politik durchzogen ist von antisemitischen Denkmustern, auch in kirchlichen Diskussionen», sagte die Bischöfin.

Jüdische Nachbarinnen und Nachbarn fühlten sich alleingelassen nach dem terroristischen Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023. Sie warteten auf Beistand und Mitgefühl. Vor diesem Hintergrund warb Bischöfin Hofmann: «Wir als christliche Kirche wollen dazu beitragen, dass die Koffer nicht gepackt werden müssen. Denn wir wollen und brauchen das Miteinander von jüdischen und christlichen Menschen und Gemeinden in unserem Land.»
Im Advent und der Vorbereitung auf Chanukka erinnerten Christinnen und Christen, Jüdinnen und Juden an die großen Verheißungen: «dass da einer kommen wird, der als Friedefürst wirken wird, in Weisheit und mit Verstand, der Licht bringen wird, wo Finsternis herrscht», erläuterte die Bischöfin und ergänzte: «Wir teilen die Aufgabe, erwartungsvoll in dieser Welt zu leben und zu glauben und zum Licht für andere Menschen zu werden. Dazu gehört, einander zuzuhören und beizustehen.»