Die Schiffe ziviler Seenotretter haben nach eigenen Angaben seit 2015 mehr als 175.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet. Im selben Zeitraum habe eine knappe Million Flüchtlinge (929.686) über das Mittelmeer Italien erreicht, teilten die Organisationen United4Rescue, Sea-Watch, Sea-Eye und SOS Humanity in Berlin zum zehnjährigen Bestehen ihrer Rettungseinsätze mit.
Mindestens 28.932 Menschen seien seit 2015 auf dem Meer ums Leben gekommen oder verschwunden, sagte Mirka Schäfer von der Organisation SOS Humanity. Mehr als 21.700 Todesfälle seien allein im zentralen Mittelmeer zwischen Libyen, Tunesien, Italien und Malta registriert worden. «Die Dunkelziffer ist aber hoch», sagte sie.
Im Durchschnitt hätten seit 2015 täglich sechs Menschen auf dem Weg über das Meer ihr Leben verloren oder würden als vermisst gelten. Wegen der wachsenden politischen und bürokratischen Schikanen gegen die zivilen Seenotretter steige die Todesrate seit 2022 wieder an, beklagte Schäfer.
Die erste Mission der «Sea-Watch 4»

Der Fotograf Thomas Lohnes hat im Sommer 2020 für den epd die erste Mission des Rettungsschiffs «Sea-Watch 4» begleitet. Fünf Wochen lang war er an Bord und nah dran: nah an den Menschen, an den Rettern und den Geretteten. Das Fotobuch gibt Einblicke in die Arbeit der Engagierten und zeigt die Menschen auf der Flucht.
Kollekte für «United4Rescue»
Die Kollekte in den Gottesdiensten am 14. September ist für das von der evangelischen Kirche initiierte Bündnis bestimmt. Dann wird in den Gemeinden in der EKKW um Spenden für diese Arbeit gebeten.
Aufgabe: «Menschen vor dem Ertrinken bewahren»
Europäische Staaten und die EU setzten weiterhin auf Abschottung statt Schutz und missachteten dabei internationales Recht. Italien habe seit Januar 2023 in 28 Fällen zivile Rettungsschiffe festgesetzt. Die dadurch verlorenen Einsatzzeiten summierten sich auf mehr als 761 Tage.
«Seit zehn Jahren weigern wir uns als Zivilgesellschaft, das Sterbenlassen zu akzeptieren», sagte Schäfer. Aktuell versuchten 21 zivile Organisationen im zentralen Mittelmeer die Rettungslücke zu füllen, die eigentlich staatliche Aufgabe sei: «Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren.» Zehn der Organisationen kämen aus Deutschland. Aktuell seien im zentralen Mittelmeer 15 Rettungsschiffe, sieben Segelboote und vier Flugzeuge im Einsatz, die aber nicht alle gleichzeitig operieren.
Finanziert werden die zivilen Rettungseinsätze vor allem durch private Spenden. Unter den Spendern seien Unternehmen wie Eiscreme-Hersteller Ben & Jerry's und Fritz-Cola, wie Sandra Bils von der Organisation United4Rescue sagte. Die evangelische Theologin sprach von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis engagierter Menschen und mehr als 900 Organisationen, die «dem Sterben im Mittelmeer nicht tatenlos zusehen wollen».
Fünf Fragen zur zivilen Seenotrettung
1. Wieso werden alle Geretteten nach Europa gebracht? Könnten die Rettungsschiffe die Menschen nicht zurück nach Nordafrika bringen?
Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, müssen an den nächsten «Sicheren Ort» (Place of safety/POS) gebracht werden. So sieht es Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vor. Menschen zurück in die Gefahr zu bringen, aus der sie fliehen, ist also illegal. Das Völkerrecht verbietet zudem, Menschen in Staaten zurückzubringen, in denen ihnen Folter oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Entsprechend ist Libyen nicht sicher. In den dortigen Internierungslagern werden Menschen gefoltert, vergewaltigt, misshandelt, versklavt. Menschen nach Nordafrika zurückzubringen, würde ihnen außerdem die Möglichkeit nehmen, einen Asylantrag zu stellen. Tunesien oder Marokko haben jedoch gar kein Asylsystem und können daher keine sicheren Orte sein.
2. Spielt die Seenotrettung nicht Schleppern in die Hände?
Nein. Die zivile Seenotrettung wurde gegründet als Reaktion auf das tausendfache Sterben im Mittelmeer. Weil legale, sichere Fluchtwege fehlen, haben die Menschen keine andere Wahl als sich in die Hände von kriminellen Schlepperbanden oder fragwürdigen Fluchthelfern zu begeben. So wird aus der Not von Menschen ein Geschäft.
In Libyen sind vor allem lokale Milizen und kriminelle Clans aktiv. Sie stellen die sogenannte Küstenwache, die von der EU mitfinanziert wird. Und sie betreiben Folterlager, in die fliehende Menschen zurückgebracht werden. So hat sich ein lukrativer Kreislauf etabliert, indem die Milizen doppelt verdienen: an der Schlepperei – wie auch dem Einfangen und Zurückbringen der Flüchtenden. Menschen, die diesem Kreislauf entkommen konnten, berichten häufig, dass sie bereits mehrfach die Überfahrt versucht haben und ihre Familien immer wieder neu um Lösegeld erpresst wurden. Diese Konfliktökonomie, bei der aus der Not von Menschen ein Geschäft wird, lässt sich nur zerschlagen, indem Not und Unrecht in Libyen beendet werden.
3. Warum fliehen Menschen überhaupt auf lebensgefährlichen Wegen?
Menschen haben ganz unterschiedliche Gründe, lebensgefährliche Fluchtwege zu wagen. Viele fliehen vor Gewalt, Terror und Not. Andere haben in ihrer Heimat ihre Lebensgrundlagen verloren, fliehen aus Verzweiflung und Perspektivlosigkeit – und hoffen auf eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien. Es sind ganz unterschiedliche Geschichten, die die Geretteten erzählen. Alle berichten jedoch, dass das Elend an Land größer war, als die Angst zu ertrinken.
Legale Einreisewege für Flüchtlinge in die EU sind so gut wie verschlossen. Diese mit der Abschottung Europas einhergehende Auslagerung der Grenzkontrollen ist der Grund für das massenhafte Sterben an den Grenzen Europas, insbesondere auf dem Mittelmeer, da sie die Menschen auf immer gefährlichere Wege zwingen. So ist die Flucht über das Mittelmeer in der Regel nur ein besonders tödlicher Abschnitt einer langen und gefährlichen Reise.
4. Schafft die zivile Seenotrettung nicht zusätzliche Anreize für noch mehr Bootsflüchtlinge?
Nein. Bootsflüchtlinge fliehen vor Krieg, Verfolgung und Not. Für die Behauptung, dass erst die zivile Seenotrettung Menschen dazu bringt, über das Mittelmeer zu fliehen, gibt es keine Belege. Diverse empirische Studien bestätigen: Es gibt die behauptete Korrelation zwischen der Präsenz von Rettungsschiffen und der Zahl von Flüchtlingsbooten nicht. Der sogenannte Pull-Effekt hat also keine faktische Grundlage.
Der Augenschein bestätigt dies: Auch wenn oft wochenlang kein einziges ziviles Rettungsschiff im Einsatz ist, fliehen viele Menschen über das Mittelmeer. Was die Studien hingegen belegen ist, dass mehr Menschen ertrinken, wenn keine Rettungsschiffe vor Ort sind.
Außerdem: Die zivile Seenotrettung ist erst ab 2015 aktiv geworden, nachdem immer mehr Menschen ertranken und staatliche Seenotrettung fehlte. Die zivile Seenotrettung ist also die Reaktion auf die Flüchtlingsboote und das Sterben im Mittelmeer – und nicht andersherum.
5. Ist nicht die Bekämpfung von Fluchtursachen wichtiger als zivile Seenotrettung?
Natürlich ist es wichtig, Fluchtursachen zu vermeiden, damit Menschen gar nicht erst fliehen müssen, sondern in ihrer Heimat in Würde und Sicherheit leben können. Doch Menschen aus Seenot zu retten, ist eine humanitäre und rechtliche Verpflichtung. Es wäre auch deswegen falsch, verschiedene Ansätze und Formen von Hilfe gegeneinander auszuspielen.
Im Flüchtlingsschutz braucht es sowohl den langfristigen Einsatz für globale Gerechtigkeit und Frieden, wie auch akute Nothilfe und Seenotrettung. Entsprechend vereint United4Rescue als Bündnis für die zivile Seenotrettung ganz unterschiedliche Akteure und Hilfsorganisationen, auch aus der Entwicklungshilfe.
Noch weitere Fragen?
Auf der Internetseite der Organisation gibt es noch weitere Fragen und Antworten und viele Informationen zur zivilen Seenotrettung: united4rescue.org
(Quelle der Texte: Flyer Jeder Mensch hat einen Namen)
«Bedingungen für unsere Arbeit werden immer schwieriger»
Sie wandte sich auch gegen eine Kriminalisierung von Seenotrettung: «Unsere gemeinsame Solidarität ist kein Verbrechen, das Sterben auf See ist ein Verbrechen», sagte Bils. Die Gründung von United4Rescue geht auf eine Resolution beim Evangelischen Kirchentag im Juni 2019 zurück, ein Rettungsschiff der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ins Mittelmeer zu entsenden. Seitdem hat die Organisation maßgeblich den Kauf von Rettungsschiffen unterstützt.
Schäfer forderte die EU-Staaten auf, «endlich Verantwortung zu übernehmen». Aktuell ließen diese «wissentlich tausende Menschen ertrinken oder in Folterlager verschleppen», indem sie Notrufe ignorierten und die Arbeit der zivilen Rettungsteams behinderten. «Die Bedingungen für unsere Arbeit werden immer schwieriger, die Behinderung unserer Rettungsflotte durch staatliche Maßnahmen eskaliert», sagte die SOS-Humanity-Sprecherin. Erst am Montag sei das Rettungsschiff «Sea-Eye 5» auf Sizilien festgesetzt worden.
www.united4rescue.org
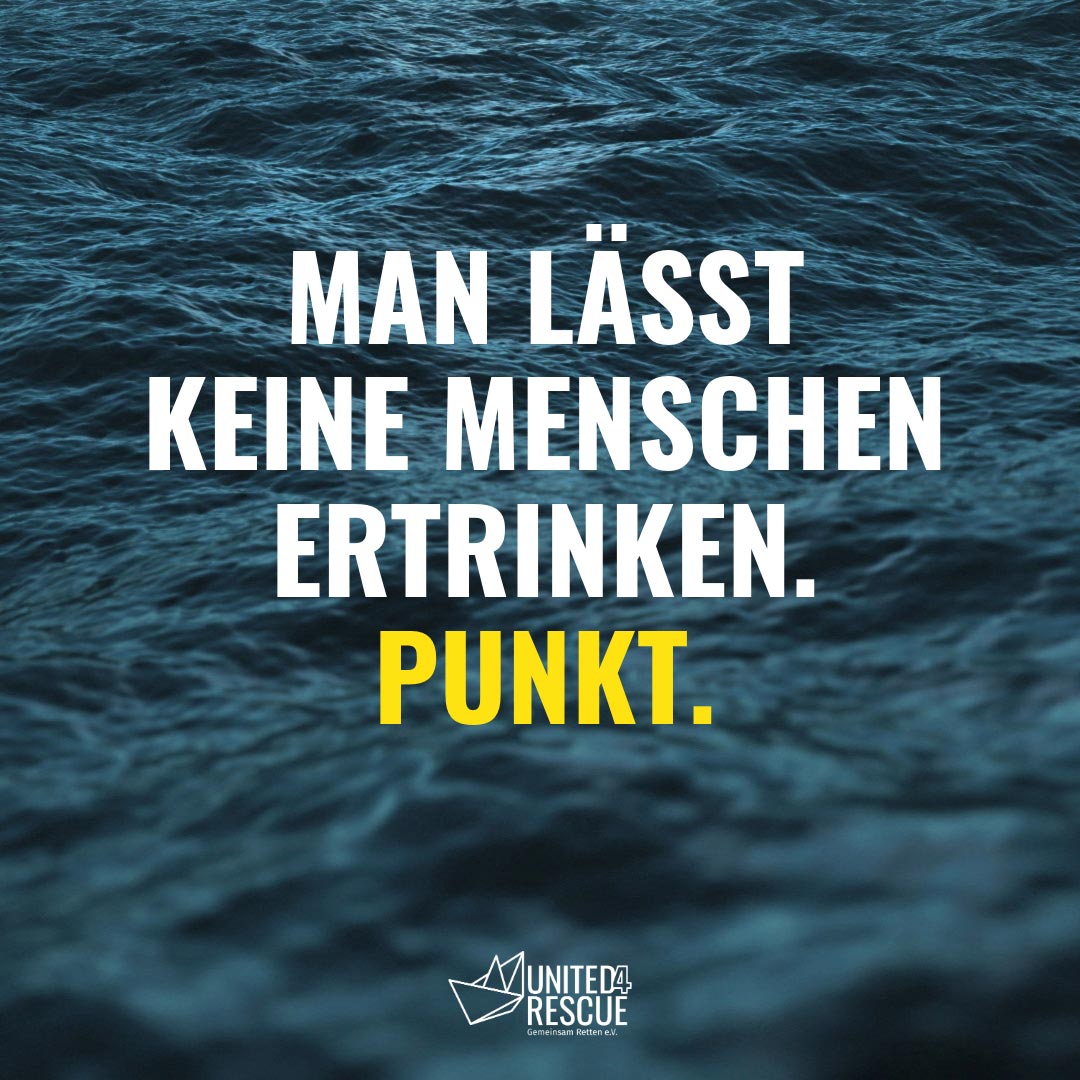
United4Rescue ist ein gemeinnütziger, unabhängiger Verein, der die Rettung von Menschenleben entlang der EU-Außengrenze und insbesondere die zivile Seenotrettung im Mittelmeer unterstützt und hilft, Leben zu retten. Mithilfe von Spenden haben wir bereits drei Rettungsschiffe in den Einsatz gebracht und viele Rettungseinsätze ermöglicht. Zugleich ist United4Rescue ein breites Bündnis hunderter Organisationen, die die Überzeugung eint, dass man keine Menschen ertrinken lässt. Das Bündnis setzt sich öffentlich für die Seenotrettung und sichere Fluchtwege ein.
United4Rescue hilft der zivilen Seenotrettung organisationsübergreifend und unbürokratisch, vor allem dort, wo akut Geld für Rettungseinsätze fehlt. Beispielsweise für den Kauf und Umbau von Rettungsschiffen, für Ausrüstung oder Einsatzkosten.
