Warten ist das zentrale Thema der Adventszeit. Sie drückt sich auch in zwei Bräuchen aus, die bei vielen Menschen gepflegt werden: dem Adventskranz und dem Adventskalender. Viele Menschen stimmen sich außerdem mit Liedern, Gebäck und Kerzenschein auf Weihnachten ein. Eines der beliebtesten und bekanntesten Adventslieder ist «Macht hoch die Tür».
Überblick:
Adventskalendertürchen auf Social Media
Im digitalen Adventskalender der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) geben in diesem Jahr Menschen aus der gesamten Landeskirche adventliche Einblicke. Mit kreativen Beiträgen und inspirierenden Aktionen zeigen sie in den sozialen Medien, wie vielfältig und lebendig die Kirche ist. Vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich an jedem Morgen ein neues Türchen auf Instagram und Facebook.
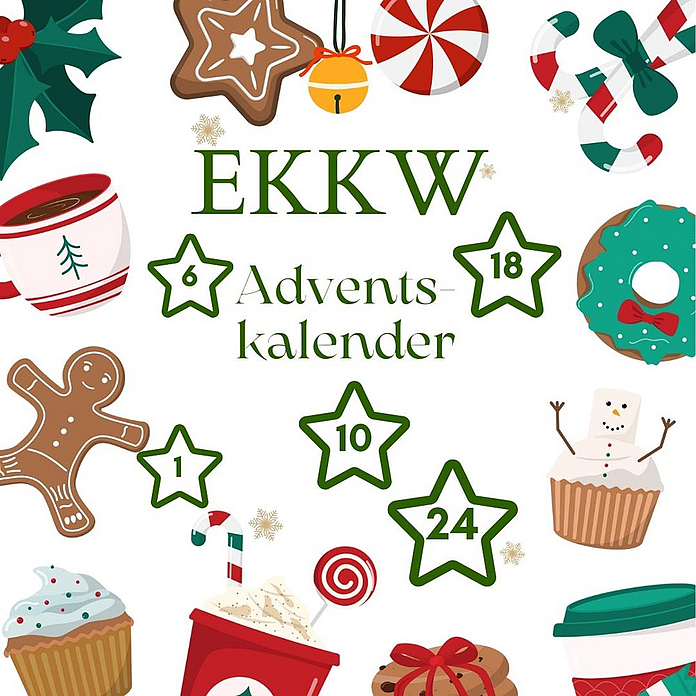
Mal nachdenklich, mal fröhlich, mal überraschend: Wer mag, kann bis zum Weihnachtsfest entdecken, was die Menschen in den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen von Kassel über Marburg, Fulda und Hanau in der Adventszeit bewegt – immer nah an den Menschen, die unsere Kirche prägen. Der Adventskalender lädt dazu ein, die Regionen der Landeskirche auf besondere Weise kennenzulernen und sich auf Weihnachten einzustimmen.

Fragen und Antworten rund um den Advent
Weihnachtsmärkte, volle Innenstädte, Geschenkestress: Die Wochen vor Heiligabend gehören zu den trubeligsten im Jahr. Dabei war der Advent ursprünglich eine Zeit des Fastens und der Einkehr. Ein Blick auf Geschichte und Bräuche rund um die Zeit vor Weihnachten:
Was bedeutet die Adventszeit für Christen?
Advent bedeutet «Ankunft». Gemeint ist damit die Zeit der Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu Christi an Weihnachten. Advent und Weihnachten entstanden als christliche Feste im 4. bis 5. Jahrhundert. Traditionell galt die Adventszeit als Buß- und Fastenzeit. Heute gehören Stollen, Marzipan und Lebkuchen in den Wochen vor Weihnachten dazu. Zeiten der Besinnung und Stille sind für Christen aber weiterhin Teil der Vorfreude auf Heiligabend.
Welche Traditionen werden gepflegt?
Viele Menschen schmücken ihr Haus mit Tannengrün, Sternen, Kerzen oder einer Krippe mit Krippenfiguren. Traditionell werden Plätzchen gebacken und adventliche Lieder gesungen. Für viele gehört ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt dazu. In Kirchen gibt es besondere Gottesdienste und Konzerte, und es werden Adventslieder gesungen.
Welche besondere Bedeutung hat das Licht?
Das Flackern einer Kerze, ein beleuchteter Weihnachtsstern: Ein Licht inmitten der Dunkelheit strahlt eine besondere Geborgenheit aus. Die von Sonntag zu Sonntag heller werdenden Kerzen am Adventskranz symbolisieren das Kommen Gottes in die Welt, das an Weihnachten gefeiert wird. «Ich bin das Licht der Welt», sagt Jesus im Johannesevangelium.
Wer erfand den Adventskranz?
Der Hamburger Pfarrer Johann Hinrich Wichern (1808–1881) gilt als Erfinder des Adventskranzes: Er ließ 1839 in dem von ihm gegründeten «Rauhen Haus», einem Heim für verwahrloste Jugendliche, einen großen Holzkranz aufhängen. An jedem Tag bis Heiligabend zündete Wichern eine Kerze an, um den Kindern die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen. Damals diente ein Wagenrad als Adventskranz. Heute sind die Adventskränze traditionell aus Tannen gebunden und tragen nur noch vier Kerzen – für jeden Sonntag eine.
Und wer den Adventskalender?
Auf die Idee eines Adventskalenders kamen viele. Bereits 1902 brachte ein evangelischer Verlag in Hamburg eine «Warteuhr» für Kinder heraus. Auf Anhieb ein Erfolg war der gedruckte Adventskalender des Pfarrerssohns Gerhard Lang aus Maulbronn von 1908: eine Art Ausschneidebogen mit 24 Feldern. Bis Weihnachten konnten die Kinder jeden Tag ein Motiv ausschneiden, das Gedicht darunter lesen und ein Bild aufkleben. Ab 1920 boten auch andere Firmen Adventskalender an: ein Haus zum Aufstellen zum Beispiel oder Türchen, hinter denen transparente Bilder zu sehen waren. Vor rund 100 Jahren kam dann auch die Schokolade in den Kalender. Heute bieten viele Unternehmen ihre Produkte in Form von Adventskalendern an. Eine Alternative sind selbstgebastelte Kalender oder Geschichten, die von Tag zu Tag weitererzählt werden.
Wie lange dauert die Adventszeit?
Der Advent hat vier Adventssonntage und dauert zwischen drei und knapp vier Wochen. Am 3. Dezember 1038 bestimmte eine Synode, ein Treffen von Kirchenleuten, im pfälzischen Kloster Limburg: Der erste Adventssonntag muss stets in der Zeit zwischen dem 27. November und dem 3. Dezember begangen werden. Der vierte Advent kann mit dem Heiligen Abend am 24. Dezember zusammenfallen. Vorher hatte es je nach Region im Reich vier, fünf, sechs oder auch sieben Adventssonntage gegeben. Im evangelischen Kirchenjahr folgt der erste Advent auf den Ewigkeitssonntag (Totensonntag).
«Durch die Bank – dein Podcast im Advent»
Mit einem neuen Audioformat aus dem Vikariat der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck will Vikar Yorick Weise zeigen, wie Advent heute erlebt wird. Der Podcast bietet bis Weihnachten fünf Gespräche mit unterschiedlichen Gästen zu persönlichen Erfahrungen, Traditionen und Herausforderungen der Adventszeit. Weise will damit Menschen auf zeitgemäße Weise erreichen und einen entspannten Zugang zu dieser besonderen Phase des Kirchenjahres schaffen. Sein Ziel: Die Vielfalt adventlicher Perspektiven hörbar machen. Das Projekt ist Teil der Praxisausbildung zum Pfarrberuf.

Adventsgeschichten der Ausbildungshilfe
«Singt von Hoffnung für die Welt…» lautet in diesem Jahr der Titel des Adventskalenders der Ausbildungshilfe (Christian Education Fund) der EKKW. Hinter den 24 Türchen finden sich stimmungsvolle adventliche Impressionen sowie Fotos von Menschen aus Partnerkirchen der EKKW. Die Besonderheit: Unter der Rufnummer (0561) 9378 278 und hier auf ekkw.de kann an jedem Adventssonntag eine neue Geschichte angehört werden. Es spricht Pfarrer Armin Beck, Geschäftsführer des Christian Education Fund.

Auf dem Adventskalender der Ausbildungshilfe ist die Stiftskirche in Kaufungen im Advent abgebildet.

«adventus» = Ankunft
Advent - vom lateinischen Wort «adventus» für Ankunft - ist die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten. Advent und Weihnachten entstanden als christliche Feste erst im 4. bis 5. Jahrhundert. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt auch das neue Kirchenjahr, während das vorherige mit dem Toten- oder Ewigkeitssonntag zu Ende ging. Der Advent wiederum endet, wenn am Heiligen Abend (24. Dezember) die Sonne untergeht.
In die Zeit des Advents fällt am 21. Dezember auch die Wintersonnenwende. Die Tage werden danach wieder länger und lassen das Ende von Winter und Dunkelheit erahnen. Die vier Adventssonntage sollen in der christlichen Tradition auf die wachsende Nähe Gottes zu den Menschen einstimmen, für die die Geburt Jesu an Weihnachten steht.
67. Spendenaktion «Brot für die Welt»
Die Spendenaktion «Brot für die Welt» startet am 1. Advent mit einem Eröffnungsgottesdienst im Evangelischen Gemeindezentrum Bodenheim-Nackenheim in Hessen. Den Gottesdienst gestalten u.a. Ulrike Scherf, Stellvertretende Kirchenpräsidentin der EKHN, und Dr. Diethelm Meißner, Diakonie- und Ökumene-Dezernent der EKKW. Im Mittelpunkt steht das Motto «Kraft zum Leben schöpfen – Gemeinsam für Wasser, Ernährungssicherung und Klimagerechtigkeit». Das Projekt «Sicher vor dem Sturm» auf Fidschi wird vorgestellt, bei dem sturmsichere Häuser entstehen.

Zeitgleich findet die bundesweite Eröffnung mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Durlach in Karlsruhe statt. Die Predigt halten Pfarrerin Dagmar Pruin, Präsidentin von «Brot für die Welt», Reverend James Bhagwan, Generalsekretär der Pazifischen Konferenz der Kirchen, und Heike Springhart, Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden. Der Gottesdienst wird live im Ersten und per Livestream übertragen.

Adventskranz
Der Countdown läuft bis Weihnachten. Dafür zünden wir jetzt auch Kerzen auf dem Adventskranz an. Früher waren das sogar 24 Kerzen, üblich sind heute noch vier. Über die Bedeutung der Kerzen auf dem Adventskranz spricht Torsten Scheuermann im Wort zur Woche mit Pfarrerin Ute Engel aus Hanau.
