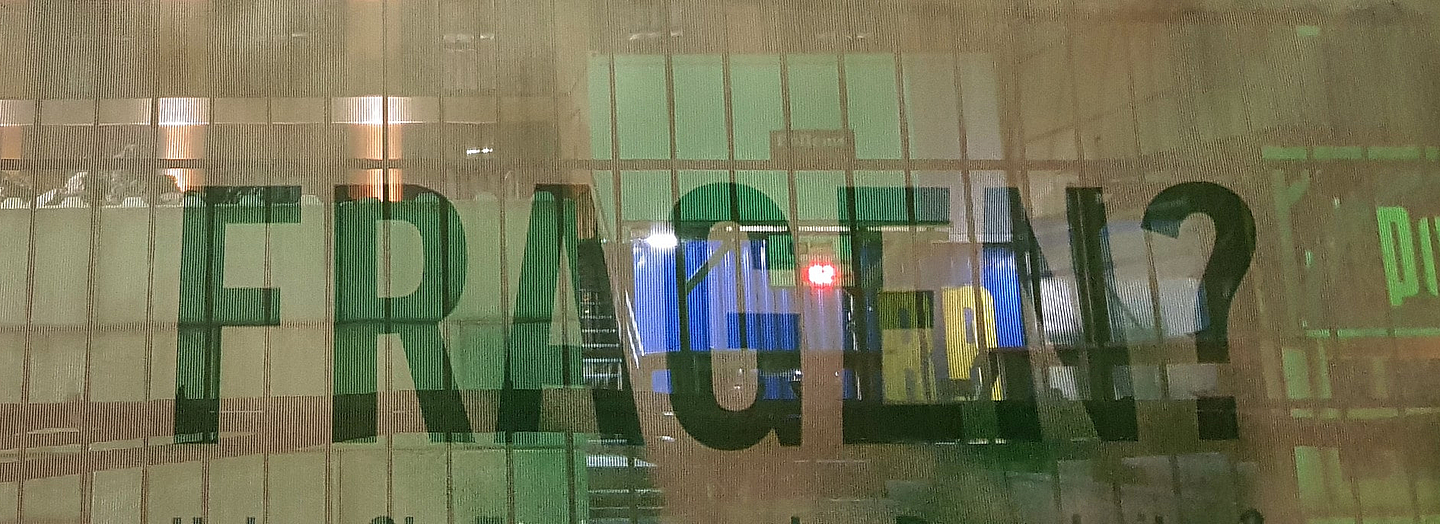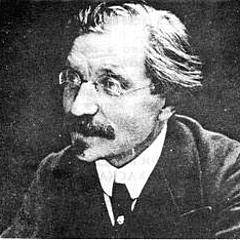Die 14. Landessynode der EKKW hat am 25. April 2024 folgenden Beschluss gefasst:
1. Alle Kirchenkreise erstellen bis spätestens zum 01.01.2026 einen Gebäudeplan für alle Gebäude im Kirchenkreis.
2. Alle Kirchenkreise bedienen sich zur Vorbereitung der Gebäudepläne einer hierfür zur Verfügung gestellten einheitlichen Matrix.
3. Bei der Aufstellung des Gebäudeplanes sind alle Gebäude eines Kirchenkreises in den Blick zu nehmen.
Bei der Betrachtung der Pfarrhäuser sind insbesondere die Entwicklung der Kirchenkreise und der Pfarrstellen im Kirchenkreis mit zu berücksichtigen.
4. Angesichts der Finanzentwicklung geht die Landessynode derzeit davon aus, dass 30 % der Gebäude aufzugeben sind und gleichzeitig zukünftig nur noch 30 % der kirchlichen Gebäude antragsberechtigt für kirchliche Bau- und Unterhaltungsmittel sind.
Die Landessynode sieht die Zielgröße der 30 % auch für Pfarrhäuser vor.
Stichtag der Berechnung ist der Gebäudebestand am 01.01.2020.
Daher ist für alle Gebäude über alternative Nutzungs- und Finanzierungskonzepte nachzudenken.
5. Die Ergebnisse des Gebäudeprozesses werden mit einem Ampelsystem durch die
Kreissynode im Gebäudeplan dargestellt.
Rot: Keine Zuweisung. Empfehlung zur Aufgabe
Gelb: Keine Zuweisung. Umnutzung oder alternative Finanzierung
Grün: Antragsberechtigung auf Mittelzuweisung
6. Die Landessynode empfiehlt den Kirchenkreisen, den Gebäudeprozess unter Nutzung der Chancen der Kooperationsräume durchzuführen. Keine Gemeinde kann sich dem Prozess entziehen.
7. Die Gebäudepläne orientieren sich an den Klimaschutzzielen der Landeskirche mit dem Gesamtziel der Klimaneutralität bis 2045. Kirchliche Mittel für die energetische Ertüchtigung von Gebäuden sollen nur für Gebäude, die antragsberechtigt sind (Kategorie grün), bereitgestellt werden.
8. Der Rat der Landeskirche wird beauftragt mit dem Land Hessen und dem Freistaat
Thüringen in Gespräche über die denkmalschutzrechtlichen Grundsätze für kirchliche Gebäude einzutreten.